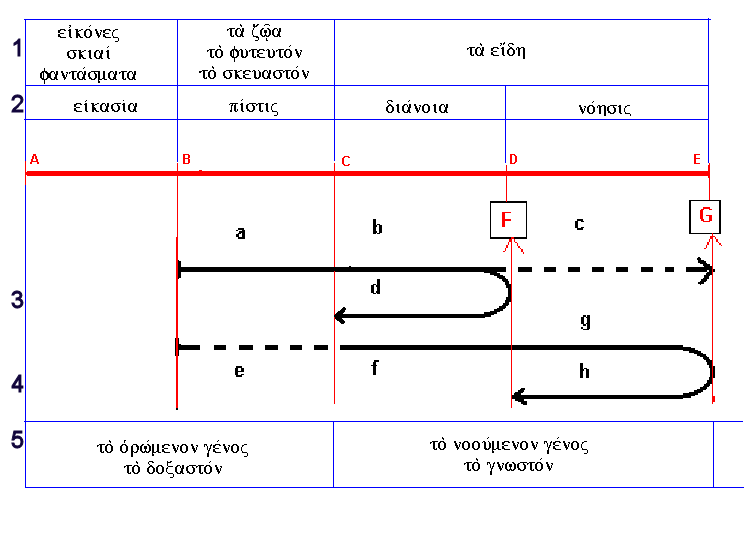(
509d) Ὥσπερ τοίνυν γραμμὴν δίχα τετμημένην λαβὼν ἄνισα τμήματα, πάλιν τέμνε ἑκάτερον τὸ τμῆμα ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τό τε τοῦ ὁρωμένου γένους καὶ τὸ τοῦ νοουμένου, καί σοι ἔσται σαφηνείᾳ καὶ ἀσαφείᾳ πρὸς ἄλληλα ἐν μὲν τῷ ὁρωμένῳ (509e) τὸ μὲν ἕτερον τμῆμα εἰκόνες - λέγω δὲ τὰς εἰκόνας πρῶτον (
510a) μὲν τὰς σκιάς, ἔπειτα τὰ ἐν τοῖς ὕδασι φαντάσματα καὶ ἐν τοῖς, ὅσα πυκνά τε καὶ λεῖα καὶ φανὰ συνέστηκεν, καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον, εἰ κατανοεῖς.
Als wenn du also eine in zwei ungleiche Abschnitte geteilte Linie hättest, teile wiederum jeden der beiden Abschnitten, sowohl den des sichtbaren als auch des erkennbaren Bereiches, wieder nach demselben Verhältnis, und du wirst zunächst nach Deutlichkeit und Undeutlichkeit zueinander an dem einen Teilabschnitte Bilder haben. (510a) Ich meine aber mit Bildern erstlich die Schatten, dann Spiegelungen im Wasser und in allem, was dicht, glatt und reflektierend ist, und in allem derartigen, wenn du es begreifst?
Ἀλλὰ κατανοῶ.
Ja, ich begreife.
Τὸ τοίνυν ἕτερον τίθει, ᾧ τοῦτο ἔοικεν, τά τε περὶ ἡμᾶς ζῷα καὶ πᾶν τὸ φυτευτὸν καὶ τὸ σκευαστὸν ὅλον γένος.
Unter dem anderen Unterabschnitt, dem dieser gleicht, denke dir sodann die uns umgebenden Tiere, alle Pflanzen und alles Gefertigte.
Τίθημι, ἔφη.
Ich tue es, sagte er.
Ἦ καὶ ἐθέλοις ἂν αὐτὸ φάναι, ἦν δ' ἐγώ, διῃρῆσθαι ἀληθείᾳ τε καὶ μή, ὡς τὸ δοξαστὸν πρὸς τὸ γνωστόν, οὕτω τὸ ὁμοιωθὲν πρὸς τὸ ᾧ ὡμοιώθη;
Wärst du denn nun auch bereit, fuhr ich fort, einzuräumen, dass er auch nach Wahrheit und Unwahrheit zweigeteilt ist, dass sich nämlich das Meinbare zu dem Erkennbaren so verhält wie die Kopie zum Original?
(
b) Ἔγωγ', ἔφη, καὶ μάλα.
O ja, sagte er, sehr gerne.
Σκόπει δὴ αὖ καὶ τὴν τοῦ νοητοῦ τομήν, ᾗ τμητέον.
So prüfe denn auch, wie das Erkennbare zu unterteilen ist!
Ἧι τὸ μὲν αὐτοῦ τοῖς τότε μιμηθεῖσιν ὡς εἰκόσιν χρωμένη ψυχὴ ζητεῖν ἀναγκάζεται ἐξ ὑποθέσεων, οὐκ ἐπ' ἀρχὴν πορευομένη ἀλλ' ἐπὶ τελευτήν, τὸ δ' αὖ ἕτερον - τὸ ἐπ' ἀρχὴν ἀνυπόθετον - ἐξ ὑποθέσεως ἰοῦσα καὶ ἄνευ τῶν περὶ ἐκεῖνο εἰκόνων, αὐτοῖς εἴδεσι δι' αὐτῶν τὴν μέθοδον ποιουμένη.
Indem die Seele gezwungen wird, im einen Abschnitt sich des damals Nachgeahmten als Bilder zu bedienen und von Voraussetzungen aus nicht zum Prinzip weiterzugehen, sondern zu einem vorläufigen Ende, im anderen Abschnitt aber - dem zum voraussetzungslosen Prinzip - von einer Voraussetzung auszugehen und ohne diesbezügliche Bilder nur mit Hilfe der Ideen selbst durch sie ihren methodischen Weg zu nehmen.
Ταῦτ', ἔφη, ἃ λέγεις, οὐχ ἱκανῶς ἔμαθον.
Was du damit meinst, habe ich nicht recht verstanden.
(
c) Ἀλλ' αὖθις, ἦν δ' ἐγώ· ῥᾷον γὰρ τούτων προειρημένων μαθήσῃ. οἶμαι γάρ σε εἰδέναι, ὅτι οἱ περὶ τὰς γεωμετρίας τε καὶ λογισμοὺς καὶ τὰ τοιαῦτα πραγματευόμενοι, ὑποθέμενοι τό τε περιττὸν καὶ τὸ ἄρτιον καὶ τὰ σχήματα καὶ γωνιῶν τριττὰ εἴδη καὶ ἄλλα τούτων ἀδελφὰ καθ' ἑκάστην μέθοδον, ταῦτα μὲν ὡς εἰδότες, ποιησάμενοι ὑποθέσεις αὐτά, οὐδένα λόγον οὔτε αὑτοῖς οὔτε ἄλλοις ἔτι ἀξιοῦσι περὶ αὐτῶν διδόναι (
d) ὡς παντὶ φανερῶν, ἐκ τούτων δ' ἀρχόμενοι τὰ λοιπὰ ἤδη διεξιόντες τελευτῶσιν ὁμολογουμένως ἐπὶ τοῦτο, οὗ ἂν ἐπὶ σκέψιν ὁρμήσωσι.
Also noch einmal, erwiderte ich; du wirst es nach folgener Vorklärung leichter verstehen: Du weißt ja wohl, dass die, die sich mit Geometrie und Arithmetik und dergleichen abgeben, den Begriff von Gerade und Ungerade, von Figuren und den drei Arten von Winkeln und sonst dergleichen bei jedem Beweisverfahren voraussetzen, als hätten sie über diese Begriffe ein Wissen, während sie diese doch nur als Voraussetzungen aufstellen und glauben, weder sich noch anderen davon Rechenschaft schuldig zu sein, als seien sie allen klar. Von diesen Annahmen gehen sie aus, führen dann das Weitere durch und kommen so endlich folgerrichtig zu dem Ziel, auf dessen Erforschung sie ausgegangen waren.
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, τοῦτό γε οἶδα.
Ja, sagte er, das weiß ich allerdings.
Οὐκοῦν καὶ ὅτι τοῖς ὁρωμένοις εἴδεσι προσχρῶνται καὶ τοὺς λόγους περὶ αὐτῶν ποιοῦνται, οὐ περὶ τούτων διανοούμενοι, ἀλλ' ἐκείνων πέρι, οἷς ταῦτα ἔοικε, τοῦ τετραγώνου αὐτοῦ ἕνεκα τοὺς λόγους ποιούμενοι καὶ διαμέτρου αὐτῆς, (
e) ἀλλ' οὐ ταύτης ἣν γράφουσιν, καὶ τἆλλα οὕτως, αὐτὰ μὲν ταῦτα ἃ πλάττουσίν τε καὶ γράφουσιν, ὧν καὶ σκιαὶ καὶ ἐν ὕδασιν εἰκόνες εἰσίν, τούτοις μὲν ὡς εἰκόσιν αὖ χρώμενοι, ζητοῦντες (
511a) δὲ αὐτὰ ἐκεῖνα ἰδεῖν, ἃ οὐκ ἂν ἄλλως ἴδοι τις ἢ τῇ διανοίᾳ.
Nicht wahr, auch dass sie sich der sichtbaren Dinge bedienen und ihretwegen Untersuchungen anstellen, während sie doch nicht über diese nachdenken, sondern über das, dem diese gleichen? Nur dem Viereck selbst und seiner Diagonale selst gilt ihre Untersuchung, nicht denen, die sie aufzeichnen, und so in allem sonst. Selbst das, was sie bilden und zeichnen, wovon es auch Schatten und Bilder im Wasser gibt, auch das gebrauchen sie weiter nur als Bild und suchen dadurch zur Schau dessen zu gelangen, (511a) was man nur mit dem Verstand schauen kann.
Ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις.
Richtig bemerkt, sagte er.
Τοῦτο τοίνυν νοητὸν μὲν τὸ εἶδος ἔλεγον, ὑποθέσεσι δ' ἀναγκαζομένην ψυχὴν χρῆσθαι περὶ τὴν ζήτησιν αὐτοῦ, οὐκ ἐπ' ἀρχὴν ἰοῦσαν, ὡς οὐ δυναμένην τῶν ὑποθέσεων ἀνωτέρω ἐκβαίνειν, εἰκόσι δὲ χρωμένην αὐτοῖς τοῖς ὑπὸ τῶν κάτω ἀπεικασθεῖσιν καὶ ἐκείνοις πρὸς ἐκεῖνα ὡς ἐναργέσι δεδοξασμένοις τε καὶ τετιμημένοις.
Das also meinte ich vorhin mit 'denkbarem Bereich' und dass die Seele bei seiner Erforschung gezwungen sei, von Voraussetzungen auszugehen, indem sie nicht zum Prinzip zurückgeht, weil sie über ihre Voraussetzungen nicht hinausgehen kann, sondern dass sie dabei die Bilder verwende, die von Dingen darunter abgebildet werden und von ihnen im Vergleich zu jenen als deutlich bewertet und geschätzt werden.
(
b) Μανθάνω, ἔφη, ὅτι τὸ ὑπὸ ταῖς γεωμετρίαις τε καὶ ταῖς ταύτης ἀδελφαῖς τέχναις λέγεις.
Ich begreife, sagte er, dass du die unter der Geometrie und den damit verwandten Disziplinen begriffene Wissenschaft meinst.
Τὸ τοίνυν ἕτερον μάνθανε τμῆμα τοῦ νοητοῦ λέγοντά με τοῦτο, οὗ αὐτὸς ὁ λόγος ἅπτεται τῇ τοῦ διαλέγεσθαι δυνάμει, τὰς ὑποθέσεις ποιούμενος οὐκ ἀρχὰς ἀλλὰ τῷ ὄντι ὑποθέσεις, οἷον ἐπιβάσεις τε καὶ ὁρμάς, ἵνα μέχρι τοῦ ἀνυποθέτου ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν ἰών, ἁψάμενος αὐτῆς, πάλιν αὖ ἐχόμενος τῶν ἐκείνης ἐχομένων, οὕτως ἐπὶ τελευτὴν καταβαίνῃ, (
c) αἰσθητῷ παντάπασιν οὐδενὶ προσχρώμενος, ἀλλ' εἴδεσιν αὐτοῖς δι' αὐτῶν εἰς αὐτά, καὶ τελευτᾷ εἰς εἴδη.
So begreife also auch, dass ich unter dem anderen Abschnitt des Denkbaren das verstehe, was die Vernunft durch die Macht der Dialektik erfasst, wobei sie ihre Voraussetzungen nicht als Prinzipien ausgibt, sondern als wirkliche Voraussetzungen, gleichsam nur als Eintritts- und Anlaufpunkte, damit sie zu dem voraussetzungslosen Prinzip des Ganzen gelangt, und wenn sie es erfasst hat, an alles sich haltend, was mit ihm in Zusammenhang steht, zum Ende herabsteige, ohne das sinnlich Wahrnehmbare dabei zu verwenden, sondern nur die Ideen selbst durch und für sich und mit Ideen auch abschließe.
Μανθάνω, ἔφη, ἱκανῶς μὲν οὔ - δοκεῖς γάρ μοι συχνὸν ἔργον λέγειν - ὅτι μέντοι βούλει διορίζειν σαφέστερον εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ διαλέγεσθαι ἐπιστήμης τοῦ ὄντος τε καὶ νοητοῦ θεωρούμενον ἢ τὸ ὑπὸ τῶν τεχνῶν καλουμένων, αἷς αἱ ὑποθέσεις ἀρχαὶ καὶ διανοίᾳ μὲν ἀναγκάζονται, ἀλλὰ μὴ αἰσθήσεσιν αὐτὰ θεᾶσθαι οἱ θεώμενοι, διὰ δὲ τὸ μὴ ἐπ' ἀρχὴν (
d) ἀνελθόντες σκοπεῖν ἀλλ' ἐξ ὑποθέσεων, νοῦν οὐκ ἴσχειν περὶ αὐτὰ δοκοῦσί σοι, καίτοι νοητῶν ὄντων μετὰ ἀρχῆς. διάνοιαν δὲ καλεῖν μοι δοκεῖς τὴν τῶν γεωμετρικῶν τε καὶ τὴν τῶν τοιούτων ἕξιν ἀλλ' οὐ νοῦν, ὡς μεταξύ τι δόξης τε καὶ νοῦ τὴν διάνοιαν οὖσαν.
Ganz verstehe ich das nicht, sagte er, denn du scheinst da eine gewaltige Aufgabe vorzutragen. Aber soviel verstehe ich doch, du willst feststellen, dass die Sicht der auf das Seiende und Gedachte gerichtete Wissenschaft der Dialektik sicherer und deutlicher ist als die der sogenannten Einzelwissenschaften, für die die Voraussetzungen zugleich Prinzip sind und deren Vertreter ihren Gegenstand zwar mit dem Verstand betrachten müssen, aber nicht mit den Sinnen; weil sie aber nicht vom Prinzip her forschen, sondern von Voraussetzungen aus, scheinen sie dir dabei keine Vernunft zu haben, obwohl auch dies vom Prinzip her einsehbar wäre. Verstandes- aber, und nicht Vernunftätigkeit scheinst du mir das Verfahren der Geometrie und der ihr verwandten Wissenschaften zu nennen, da du sie für etwas Mittleres hältst zwischen bloßer Meinung und Vernunft.
Ἱκανώτατα, ἦν δ' ἐγώ, ἀπεδέξω. καί μοι ἐπὶ τοῖς τέτταρσι τμήμασι τέτταρα ταῦτα παθήματα ἐν τῇ ψυχῇ γιγνόμενα λαβέ, νόησιν μὲν ἐπὶ τῷ ἀνωτάτω, διάνοιαν (
e) δὲ ἐπὶ τῷ δευτέρῳ, τῷ τρίτῳ δὲ πίστιν ἀπόδος καὶ τῷ τελευταίῳ εἰκασίαν, καὶ τάξον αὐτὰ ἀνὰ λόγον, ὥσπερ ἐφ' οἷς ἐστιν ἀληθείας μετέχει, οὕτω ταῦτα σαφηνείας ἡγησάμενος μετέχειν.
Das hast du durchaus richtig aufgefasst, sprach ich. Und so lass denn jenen vier Abschnitten auch vier Seelenzustände entsprechen, Vernunfttätigkeit dem obersten, Verstandestätigkeit dem zweiten, dem dritten aber weise den Glauben und dem vierten die bildliche Erkenntnis zu, und ordne sie nach dem Verhältnis, dass du ihnen denjenigen Grad von Deutlichkeit beimisst, der dem Anteil entspricht, den ihre Objekte an der Wahrheit haben.
Μανθάνω, ἔφη, καὶ συγχωρῶ καὶ τάττω, ὡς λέγεις.
Ich verstehe, sagte er, und räume es ein und ordne sie wie du sagst.
Das
Liniengleichnis (Platon, Politeia 509d6 - 511e5)
Es wird empfohlen, mit doppelsprachigem Text oder Übersetzung zu arbeiten.
Das Liniengleichnis versucht, in rationaler Begrifflichkeit zu fassen, was im Sonnengleichnis in bildhafter Analogie sichtbar wurde. Die Anschauung ist auf die Linie reduziert, die Proportion ist nicht Bild, sondern wesenhafte Struktur im Bereich des Seins und Erkennens. Daher die hohe Anforderung des Textes.
Die Zuordnung der einzelnen Linienabschnitte wird in Anlehnung an das Sonnengleichnis gelingen. Schwieriger ist die Beschreibung der Methoden zu verstehen, die im noetischen Bereich unterschieden werden und jeweils zwei Bereiche übergreifen:
- Die Methode der Fachwissenschaften: Sie gehen induktiv vom Erfahrungsbereich (τὰ ὁρώμενα εἴδη, 510d5) aus. Die allgemeinen Aussagen und Gesetzmäßigkeiten aber, die sie über die Wirklichkeit aufstellen, beanspruchen ideale Gültigkeit, gelten also für das Ding an sich. Den konkreten Dingen kommt dabei in ihrer Vielzahl und Beliebigkeit nur mehr die Bedeutung annähernder Beispiele, von Abbildungen des einen idealen Gegenstandes zu. Der Verweis auf den Unterschied zwischen dem jeweils gezeichneten und dem einen nur in Gedanken existierenden Viereck leuchtet ein. Wir erinnern uns auch an das Verhältnis von Real- und Idealstaat.
- Bei dieser Forschungsweise unterziehen nun die Fachwissenschaftler ihre vorausgesetzten Grundlagen (ὑποθέσεις) keiner weiteren Prüfung mehr; bei diesen unmittelbar einleuchtenden (evidenten) Axiomen (Beispiele werden 510c4 genannt) endet die Aufgabe der Einzelwissenschaften (τελευτή, 510b6); sie dringen nicht zu einem voraussetzungslosen Anfang (ἀρχή, 510b7 u.ö.) vor.
- Gerade dies ist die Aufgabe der Philosophie (als Wissenschaftstheorie) und ihrer dialektischen Methode (ἡ τοῦ διαλέγεσθαι δύναμις, 511b4). Sie steigt von den ὑποθέσεις als wirklichem Ausgangspunkt auf und gelangt auf rein begrifflichem Weg (Dihairesis des inneren Zusammenhangs der Ideen?), also ohne empirische Beobachtungen zur Erkenntnis einer letzten, ihrerseits voraussetzungslosen Ur-Sache (ἡ τοῦ παντὸς ἀρχή, 511b7), die wir im Sonnengleichnis bereits als Idee des Guten kennen lernten.
- Die Umkehrung der Methode, also die Anwendung der höchsten Einsicht auf das Denken insgesamt, ist dabei ebenso erforderlich wie die Anwendung mathematischer Sätze oder überhaupt wissenschaftlicher Ergebnisse auf die Wirklichkeit des Alltagslebens.
Griech. zu "Platon" und "Staat"
Einheit der Polis. Eine Studie über Platons Staat
Ballauff, T.
Idee der Paideia.. zu Plat.Höhlengleichnis u.Parmenides Lehrged
Balzert, M.
Das 'Trojanische Pferd der Moral'. Die Gyges-Geschichte bei Platon und Cicero.
Demandt, A.
Der Idealstaat. Die politischen Theorien der Antike
Meyerhöfer, H.
Platons Politeia - Ciceros De re publica. Versuch eines Vergleichs
Pöhlmann, R.v.
Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, I/II; 3. Aufl., durchges. u. um einen Anhang verm. v. Fr. Oertel. I-II
Pöhlmann, R.v.
Salin, E.
Zenons Politeia. Xenophons Kyrupädie. Theopompos' Meropis
Utopia und Utopie: Thomas Morus, die Geschichte der Utopie und die Kontroverse um ihren Begriff